Die vom Bundesrat vorgesehene höhere Eigenbeteiligung an der Prozesskostenhilfe ist mit der Verfassung vereinbar. Dieser Ansicht hat jedenfalls der Bonner Jura-Professor Christian Hillgruber in einer Anhörung zu dem zugehörigen Gesetzentwurf (BT-Drs. 16/1994) am 14.11.2007 vertreten. Ganz anderer Meinung war beispielsweise Helmut Büttner, ehemaliger Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Köln: Der Gesetzgeber müsse dafür Sorge tragen, dass auch die Leute, die kein Geld hätten, in die Lage versetzt würden, ihre Belange vor Gericht zu vertreten.
Die von der Länderkammer vorgesehenen Änderungen wahren nach Ansicht von Professor Hillgruber die Grenze des Existenzminimums. Sie führten lediglich dazu, dass diejenigen, deren Einkommen und Vermögen über das im Sozialhilferecht definierte Minimum hinausgingen, Prozesskostenhilfe künftig nur noch als zinsloses Darlehen erhielten. Dieses Darlehen hätten sie durch Zahlungen aus ihrem Einkommen und Vermögen vollständig zurückzuzahlen.
Auch Eberhard Stilz, Präsident des Staatsgerichtshofs von Baden-Württemberg, betonte, der Gesetzentwurf überschreite nicht die verfassungsrechtlichen Grenzen. Die geäußerten Zweifel der Bundesregierung teile er nicht. Ingesamt, so hob der Sachverständige hervor, halte er eine Neufassung der Bestimmungen über die Prozesskostenhilfe nicht nur aus fiskalischen Erwägungen für angezeigt. Arbeitslosengeld II-Empfänger seien überhaupt nicht betroffen. Für diejenigen, die mehr verdienten, seien maßvolle Erhöhungen geplant. Die stärkere Eigenbeteiligung leiste einen Beitrag zum Kostenbewusstsein. Und Wolfram Viefhues, Richter am Amtsgericht Gelsenkirchen, betonte, in Zeiten, in denen erhebliche finanzielle Probleme bestünden, müsse es auch möglich sein, bei der Prozesskostenhilfe diejenigen, die tatsächlich finanziell leistungsfähiger seien, mit angemessenen Eigenanteilen verstärkt zu belasten.
Büttner dagegen ergänzte seinen Vortrag mit den Worten, nach der vorgeschlagenen Lösung einer Mehrheit der Bundesländer sei es nicht mehr gewährleistet, dass jeder seine Belange vor Gericht auch vertreten könne. Der Stellungnahme der Bundesregierung sei deshalb nichts hinzuzufügen. Die Regierung hatte unter anderem darauf verwiesen, dass keine Partei vor Gericht gezwungen werden dürfe, ihr Existenzminimum einzusetzen.
Elmar Herrler, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Nürnberg und Mitglied des Präsidiums des Deutschen Richterbundes, war der Meinung, es dränge sich der Verdacht auf, dass mit den vorgesehenen Maßnahmen nicht nur die Kostenstruktur verbessert werden solle, sondern der Betroffene es sich auch zweimal überlegen solle, ob er den Rechtsweg beschreiten wolle. Problematisch werde dies, wenn eine Partei wegen der finanziellen Belastung auch in einer für sie bedeutenden Sache mangels Geld eher auf ihr Recht verzichte, als weitere Einschränkungen ihrer Lebensführung hinzunehmen.


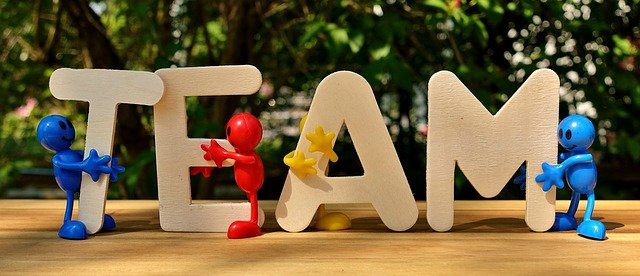
Über den Autor